Motivation zur Einhaltung der Klimaziele

Seit 1995 versammeln sich jeweils im Dezember die Unterzeichner der Klimarahmenkonvention zu Gipfeltreffen. Doch die Ergebnisse sind immer noch unbefriedigend. Warum ist es so schwierig, in Sachen Klimaschutz gemeinsam Fortschritte zu erzielen?
Axel Ockenfels: Die Anreize für internationale Kooperationen sind gering. Die Kosten nationaler Klimapolitik tragen die Steuerzahler und Stromverbraucher des Landes, das sich anstrengt. Der Nutzen nationaler Politik verteilt sich jedoch auf die ganze Welt. Sollen sich also besser die anderen anstrengen. Leider haben die Pariser Verhandler wenig dazu beigetragen, das Kooperationsproblem zu lösen.
Können Sie das genauer erklären?
Axel Ockenfels: Paris setzt auf individuelle Selbstverpflichtungen. Das kann nicht funktionieren. Stellen Sie sich zur Illustration ein typisches Experiment vor, bei dem die Verhandler – wie in Paris – um Kooperation ringen. In dem Experiment kann von zehn Verhandlern je der bis zu zehn Euro in einen „gemeinsamen Topf “ (für den Klimaschutz) einzahlen. Dann werden alle Einzahlungen verdoppelt (der Klimanutzen) und zu gleichen Teilen auf alle Verhandler aufgeteilt – unabhängig davon, wer was eingezahlt hat (niemand kann vom Klimanutzen ausgeschlossen werden).
Wenn nun alle kooperieren und 10 Euro einzahlen, sind alle besser dran und jeder erhält 20 Euro. Der Planet wird gerettet – internationaler Klimaschutz zahlt sich aus. Doch ein Land, das nicht einzahlt, kann die eigenen Kosten vermeiden und profitiert dennoch von den Anstrengungen der anderen Länder. Wenn beispielsweise neun Länder voll kooperieren, ein Land aber nicht, profitiert das eine Land wie alle anderen von den 18 Euro aus dem gemeinsamen Topf.
Es muss sich aber nicht, wie alle anderen, mit 10 Euro an den Kosten beteiligen. So kommt es zum Kooperationsversagen, obwohl ja alle Verhandler von einer Kooperation profitieren würden. Dies ist die zentrale Einsicht der Kooperationsforschung und sie beschreibt die Mutter aller Probleme, die es zu überwinden gilt.
„REZIPROZITÄT IST DER SCHLÜSSEL FÜR KOOPERATION“
Und Paris ist daran gescheitert?
Axel Ockenfels: Ja. Paris hat zwar ein gemeinsames Ziel ausgerufen und alle sind ja durchaus ehrlicherweise der Meinung, dass die Welt möglichst viel in den gemeinsamen Topf einzahlen sollte. Doch das ändert nichts daran, dass jeder einzelne Staat keinen großen Anreiz besitzt, dies auch wirklich zu tun. Das Resultat in Paris ist deshalb genau dasselbe wie in unseren Experimenten: ein Flickenteppich individueller Anstrengungen, der bei Weitem nicht ausreicht, um das gemeinsame Ziel zu erreichen.
Ist es ein Problem, dass die Verpflichtungen nicht durchgesetzt werden können?
Axel Ockenfels: Das ist nicht das zentrale Problem. Die Durchsetzungsmacht von Tempolimits hilft ja auch nichts, solange jeder Autofahrer sein individuelles Tempolimit frei selbst definieren kann. Und übrigens hilft es auch nur wenig, regelmäßig zu schauen, wo man steht, wie es sich die Pariser Verhandler vorgenommen haben. Trittbrettfahren ist nämlich ansteckender als Altruismus. Die Ambitionen, etwas anzupacken, nehmen deutlich ab, wenn sich herausstellt, dass nicht alle mitmachen.
Ein globaler CO₂-Preis als Grundlage
Gibt es einen Lösungsansatz?
Axel Ockenfels: Ja. Unzählige Feldstudien, Laborstudien und theoretische Argumente zeigen, dass erfolgreiche Kooperation nicht durch individuelle Verpflichtungen, sondern nur durch eine gemeinsame, reziproke Verpflichtung ermöglicht werden kann. Das Reziprozitätsprinzip, „Ich kooperiere, falls du kooperierst“, schützt diejenigen vor Ausbeutung durch Trittbrettfahrer, die sich für das Weltklima engagieren möchten, und schafft zugleich Anreize für alle anderen mitzumachen.
Reziprozität ist der Schlüssel für jede Art von Kooperation, von der Sharing Economy bis hin zum Aufräumen in der WG. Stellen Sie sich zur Illustration vor, wir würden die Verhandlungsregeln in dem obigen Experiment so ändern, dass die Länder am Ende nur verpflichtet wären, so viel beizutragen wie das am wenigsten ambitionierte Land. Dies wäre eine gemeinsame, reziproke Abmachung und sie schafft Vertrauen: Hohe Einzahlungen können nicht ausgebeutet werden und geringe Einzahlungen werden abgeschreckt, weil sie zu einem Kooperationskollaps und so zu Verlusten aller Beteiligten führen würden.
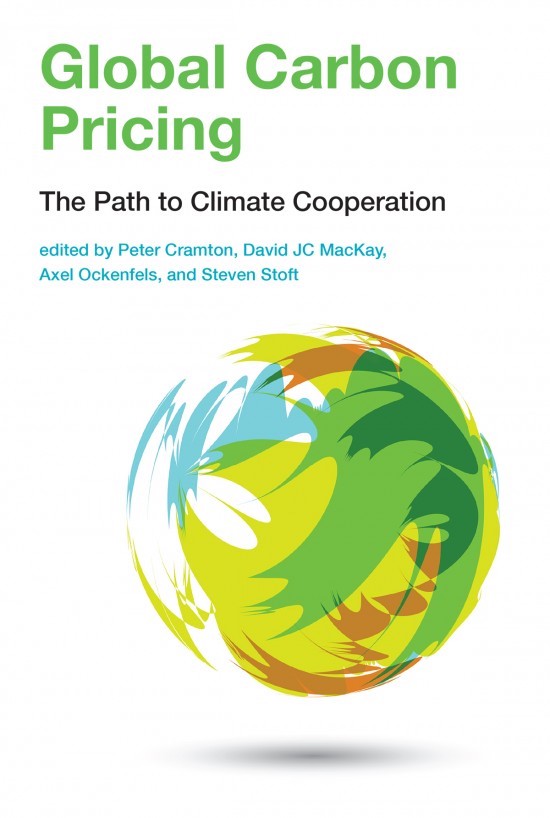
Global Carbon Pricing: The Path to Climate Cooperation
Überarbeitet Peter Cramton, David JC MacKay, Axel Ockenfels und Steven Stoft
Und wie ließe sich dies auf ein globales Klimaabkommen übertragen?
Axel Ockenfels: Ein globaler CO₂-Preis – der bisher bei internationalen Verhandlungen nicht berücksichtigt wurde – wäre aus unserer Sicht eine geeignete Grundlage für ein gemeinsames Engagement. Generell wird ein einheitlicher Kohlenstoffpreis als der kostengünstigste Weg akzeptiert, um Emissionen zu reduzieren. Das ist aber nicht der Hauptgrund für unseren Vorschlag. Ein gemeinsamer CO₂-Preis ist vergleichsweise leicht zu vereinbaren, zu handhaben und fair.
Die individuelle Preisgestaltung bleibt den Ländern überlassen und kann über fossile Steuern, Cap-and-Trade oder hybride Systeme geregelt werden. Ein CO₂-Preis erzeugt auch effektive Anreize für die notwendigen Technologieinnovationen.
Und wo landet das Geld?
Axel Ockenfels: Im Gegensatz zu einem auf globaler Ebene angestrebten Cap-and-Trade bleiben die Einnahmen aus der Emissions-Besteuerung in den jeweiligen Ländern. Das Risiko, sich teure Kredite von konkurrierenden Ländern kaufen zu müssen, wird eliminiert. Gleichzeitig muss die Kohlenstoff-Besteuerung nicht zu einer höheren Steuerlast führen. Es ist allemal besser, etwas Schädliches (CO2-Emissionen) als etwas Wünschenswertes (zum Beispiel Arbeit) zu besteuern.
Würden denn alle Länder mitmachen?
Axel Ockenfels: Unsere Forschung zeigt, dass es sehr viel leichter ist, sich auf einen Preis als beispielsweise auf eine internationale Verteilung von zulässigen Emissionsmengen zu einigen. Dennoch werden nicht alle Länder einer ambitionierten Klimapolitik zustimmen wollen. Ein Vorschlag ist, zunächst eine „Koalition der Willigen“ zu etablieren und den „Green Climate Fund“, der im Rahmen der internationalen Klimapolitik Geld einsammelt, so einzusetzen, dass Kooperation belohnt und Unterschiede in den Vermeidungskosten berücksichtigt werden.
Wenn dies nicht ausreicht, müssen weitere reziproke Maßnahmen erwogen werden. Die großen Anbieter fossiler Energieträger werden jedoch nur schwerlich von jedweder ambitionierter internationaler Klimapolitik zu überzeugen sein. In diesem Zusammenhang wird aber oft vergessen, dass ein CO₂-Preis einen Keil zwischen die Erlöse treibt, die die Anbieterländer von fossilen Energieträgern erzielen, und die Erlöse, die Verbrauchsstaaten erzielen. Im Ergebnis können durch eine CO₂-Bepreisung die Renten der Besitzer fossiler Energieträger zugunsten der Staaten mit CO₂-Preisen abgeschöpft werden.
Haben Sie Hoffnung, dass es mit der internationalen Kooperation noch klappt?
Axel Ockenfels: Ich bin meistens optimistisch. Doch solange es kein Technologiewunder gibt, wird es ohne ein Umschwenken der internationalen Politik nicht funktionieren. Selbst die beste nationale Klimapolitik nützt wenig ohne internationale Kooperation. Es geht beim CO₂-Preis nicht um etwas mehr oder weniger ökonomische Effizienz.
Es geht um die Frage, ob die Weltgemeinschaft in dem größten Kooperationsproblem der Menschheitsgeschichte vertrauensvoll zusammenarbeitet oder sich aber in einem Flickenteppich selbstzentrierter Maßnahmen verzettelt. Nach jahrzehntelanger gescheiterter internationaler Klimapolitik bleibt nur noch wenig Zeit für die Verhandler, sich jetzt endlich mit der Wissenschaft zu beschäftigen, die für die Bekämpfung des Klimawandels essenziell ist.

Axel Ockenfels ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Köln, Sprecher des Kompetenzzentrums für Sozial- und Wirtschaftsverhalten und Träger des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preises. Außerdem berät er Unternehmen und Regierungs-Institutionen in Bezug auf Klimapolitik und Marktgestaltung und ist Co-Autor des Buchtitels „Global Carbon Pricing. The Path to Climate Cooperation“, das bei The MIT Press erschienen ist.

